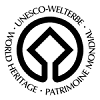Redebeitrag von
Thomas Löser
zum Neujahrsempfang
der Welterbebewegung Dresden
Liebe Freunde,
ich habe die ehrenvolle Aufgabe übertragen bekommen, einen Rückblick über die Aktivitäten der Welterbebewegung zu geben. Bei der Vorbereitung zu diesem Beitrag habe ich versucht, die wichtigsten Ereignisse des letzen Jahres zusammenzustellen und ich bin daran gescheitert. Nicht weil ich die Ereignisse nicht mehr erinnern konnte – denn dankenswerter Weise hatte mir Herr Karthaus eine Chronik derselben zusammengestellt –, nein, es ist auf Grund der Fülle der Ereignisse schier unmöglich, darüber einen erschöpfenden Bericht zu geben. 7 Seiten zählt die Chronik der Ereignisse. Sieben Seiten A4 geben Zeugnis von unseren Anstrengungen zur Rettung des Welterbes.
Diese beeindruckende Aufzählung, liebe Dresdner, ist nur möglich durch Euern unermüdlichen Einsatz für unser Welterbe. Dafür Euch allen herzlichen Dank.
Lassen Sie mich als Sprecher des Vereins „Welterbe Erhalten durch Tunnelalternative am Waldschlösschen“ kurz auf unsere wesentlichen Aktionen zur Rettung des Welterbes eingehen:
Ausgangspunkt der Anstrengungen unserer Bürgerinitiative Elbtunnel Dresden, welche letztendlich zum Bürgerbegehren führten, war die Auflösung einer politisch verfahrenen Situation, bei der es unserer Meinung nach den politischen Kräften in Dresden nicht mehr gelang, den seit 2006 sichtbaren Konflikt zwischen der Umsetzung des Bürgerentscheids pro Waldschlößchenbrücke und dem Welterbestatus der UNESCO zu lösen.
Die politischen Parteien hatten sich durch die lang anhaltende Diskussion über die Standortfrage und die Dimensionierung des Verkehrszuges sowie überhaupt über die verkehrspolitische Notwendigkeit einer Elbquerung an dieser Stelle verrannt. Die Idee, einen Tunnel zu bauen als Kompromiss, der allen Ansprüchen gerecht wird, lag unserer Meinung nach auf der Hand. Nur musste dieser Vorschlag offensichtlich von Unbeteiligten – also aus der Bürgerschaft – kommen.
Frau Ringbeck (die Deutsche UNESCO-Verantwortliche) hatte hier im Dresdner Stadtrat bereits 2006 diesen Vorschlag zur Lösung des Problems unterbreitet, nachdem er ja bereits 2004 durch die Bürgerinitiative Verkehrsfluss und die Grüne Liga beim Planfeststellungsbeschluss in die Diskussion eingebracht worden war.
Bevor wir in die Öffentlichkeit gingen, haben wir Gespräche mit Herrn Rohwer, Herrn Mücke, Herrn Brauns, Herrn Reuters und Herrn Baumann geführt. Ziel dieser Gespräche war es, den politischen Handlungsspielraum auszuloten, denn es war klar: wenn es vorab keine Lösung geben würde, wird dieses Thema zum Wahlkampthema 2008 werden und dies wird zu einer weiteren Verhärtung der Positionen führen müssen. Genau so ist es ja auch gekommen.
Leider brachten die Gespräche keine Ergebnisse – außer, dass die Brückenbauer einige Wochen später mit ihrer bis heute – ich will es einmal vorsichtig formulieren – Kampagne gegen den Elbtunnel begannen.
Uns blieb nun nichts anderes übrig, als sozusagen auf eigene Faust an die Öffentlichkeit zu gehen und politische Partner für unser Vorgehen zu suchen. Und dies, liebe Freunde, war nicht leicht. Vielen von uns fiel es schwer, diese an sich überdimensionierte Verkehrsplanung – welche, wie wir aus den aktuellen Verkehrsaufkommenszahlen der Stadt wissen, verkehrspolitisch höchst fragwürdig ist – auch mittels eines Tunnels als Kompromiss zu akzeptieren. Aber der Ausgangspunkt unserer Überlegungen war immer: Es gibt einen Bürgerentscheid – den pro Brücke – der gilt, ohne wenn und aber. So sind die Spielregeln innerhalb unserer Demokratie.
Aber wenn offensichtlich wird, dass sich auf Grund des alten Bürgerentscheids ein Konflikt mit dem Welterbestatus in Dresden anbahnt, muss es doch möglich sein, eine Lösung zu finden, die alle Seiten gerecht wird. Unsere Formel lautete schlicht und banal: Verkehrslösung + Welterbe = Elbtunnel.
Die Behauptung, die „Tunnelleute“ wollen gar nichts erreichen – eine Behauptung, welche erneut unwidersprochen in der letzten Stadtratssitzung zum Thema Welterbe geäußert wurde –, ist mittlerweile eine der Lebenslügen der sog. Brückenbauer (oder besser Welterbezerstörer) geworden. Sie haben sie nie belegt, sondern einfach nur aufgestellt, weil sie für ihr aggressives Konzept der Bekämpfung der Welterbebewegung notwendig ist. Ohne Behauptungen wie: der Tunnel ist nicht machbar, der Tunnel ist zu teuer, die UNESCO will keinen Tunnel, die Dresdner wollen keinen Tunnel, die UNESCO wusste ja alles, die UNESCO ist nicht verhandlungsbereit, die UNESCO ist eine willkürlich entscheidende, undemokratische Organisation hätten die sog. Brückenbefürworter keine Argumente.
Zur Legende: „Die UNESCO wusste ja alles.“ kann ich nur immer wieder auf unsere WebSite Elbtunnel-Dresden.de verweisen. Es ist unzweifelhaft, dass es Unstimmigkeiten seitens der Bewertung von ICOMOS gegeben hat. Aber genauso unzweifelhaft ist es, dass es die Aufgabe der Stadt Dresden und des Freistaates war, die ihnen bekannten Fehler in den Antragsunterlagen zu beseitigen. Das Gegenteil war der Fall. Herr Feßenmaier und der sonst um das Welterbe und Dresden so verdiente Herr Glaser haben in China die UNESCO bewusst im Unklaren gelassen und damit die verhängnisvolle Entwicklung beschleunigt, wenn nicht sogar bewusst herbeigeführt.
Es wurde in den Wochen vor genau einem Jahr klar, dass wir bei den politisch Verantwortlichen mit unseren Bitten zum Erhalt des Welterbes nichts erreichen würden. Also entschlossen wir uns dem Souverän, dem Volk, noch einmal die Möglichkeit zu verschaffen, über diesen schwierigen Sachverhalt abzustimmen. Denn kaum einem Dresdner war 2005 – als über die Waldschlößchenbrücke abgestimmt wurde – klar, dass Dresden deswegen den Welterbetitel verlieren würde. Man kann sich ja auch an dieser Stelle einmal fragen: Wie zulässig ist eigentlich ein Bürgerentscheid der de facto zur Aberkennung eines Welterbtitels führt. Wieso kann es so etwas eigentlich geben?
Leider mussten wir in den folgenden Wochen des Jahres 2008 feststellen, dass von Seiten derjenigen, die das Welterbe bewusst aufs Spiel setzten, alles unternommen wurde, um unsere Bürgerbegehren zu behindern.
Unser Bürgerbehren begann mit einer Pressekonferenz vor genau einem Jahr in den Räumen unseres Büros auf der Waldschlößchenstraße. Allen Unkenrufen zum Trotz waren wir trotz eisiger Kälte in der Lage, innerhalb der nächsten Wochen 50.000 Unterschriften zu sammeln. Dabei kämpften wir nicht nur gegen die Kälte, sondern auch gegen Widerstände, die wir so alle nicht vorhergesehen hatten:
- Es gab organisierte Störungen an den Sammelständen.
- Die Ingenieurkammer schaltete in einer großen sächsischen Tagszeitung eine Anzeige, welche wie ein redaktioneller Beitrag aussah. Darin gab sie die oben bereits benannten Wundergeschichten über einen Tunnel zum Besten. Alles Behauptungen, die vor dem Verwaltungsgericht und bei der Tunnelklausur an der TU widerlegt worden sind.
- Das Regierungspräsidium erklärte das Bürgerbegehren schon mal vorab für unzulässig, da es an der Kostendeckung scheitern würde, – bereits vor Bekanntgabe der Formulierung der Fragestellung.
- Das Amtsblatt der Stadt Dresden gab die Behauptungen der Ingenieurkammer und die Ansichten von Herrn Sittel und Herrn Koettnitz wieder – ohne Autorennennung und erweckte damit den Eindruck einer offiziellen Verlautbarung.
- Eine Arbeitsgruppe von Herren Sittel und dem Regierungspräsidium stimmte das gemeinsame Vorgehen von Stadt und Freistaat gegen das Bürgerbegehren ab.
- Die CDU Dresden verteilte ein Faltblatt mit den immer wiederkehrenden Behauptungen der Brückenbauer, unser Bürgerbegehren sei eine Lüge, es gäbe überhaupt keine Tunnelplanungen und vor allem der Tunnel ginge ja sowieso nicht.
- Der Oberbürgermeister Vogel schrieb einen Brief an Herren Bandarin, in dem er erklärt, ein Tunnel ginge nicht und die Dresdner wollen auch keinen Tunnel.
- Mit den demagogischen Einlassungen des sog. Brückenmännchens im Sächsischen Boten wurden systematisch Zweifel in der Dresdner Bevölkerung gestreut.
- Öffentlich wurde Stimmung gegen die UNESCO und das Welterbe geschürt, die in den unglaublich peinlichen Entgleisungen unserer ehemaligen Ministerpräsidenten Biedenkopf und Milbradt ihren Höhepunkt fanden.
All diese Aktivitäten hatten das Ziel, unser Bürgerbegehren zu erschweren. Als klar wurde, dass wir die erforderliche Stimmen trotzdem gewinnen würden, wurde auf Plan B umgeschaltet. Der sah vor, das Bürgerbegehren rechtlich zu verhindern. Auch dies wurde vorab schon mal angekündigt, natürlich nur vertraulich und ohne Quellennachweis.
Festzuhalten bleibt: In der Sache gab es drei Versuche, einen Bürgerentscheid herbeizuführen: zum Mehrbrückenkonzept (initiiert von der PDS), zur Waldschlößchenbrücke (initiiert von CDU, FDP und ADAC) und zum Elbtunnel (initiiert von der Welterbebewegung und den Welterbefraktionen). Nur einer wurde am Ende zugelassen, und der wird auf Teufel komm raus umgesetzt – der zur Waldschlößchenbrücke. Alle anderen wurden mit den wildesten Konstruktionen verhindert.
Was wir hier vorfinden, ist eine vordemokratische Situation, und das ist etwas, was wir uns auch längerfristig nicht bieten lassen dürfen. An diesem Punkt ist die Demokratie in Sachsen – aus parteipolitischem Kalkül – schwer beschädigt wurden. Wir haben nicht undemokratisch gehandelt, als wir nach drei Jahren Bindungsfrist eine neues Bürgerbegehren starteten. So sieht es die Gemeindeordnung, gerade für diese schwierigen Fälle, vor. Wir haben lediglich versucht, den Dresdnern die Chance zu geben, in dieser so wichtigen Frage selber zu bestimmen, ob sie Welterben bleiben wollen oder nicht. Dass dies verhindert wurde und wird, ist ein Skandal, der in seiner Dimension gerade erst erkannt wird.
Ich möchte an dieser Stelle Ihnen allen noch einmal recht herzlich danken. Sie haben – egal, wie diese Geschichte ausgeht; und wir alle sind Realisten genug zu wissen, dass die Chancen für den Erhalt des Welterbetitels nicht gut stehen – bewiesen, dass es in dieser Stadt ein kulturelles Gewissen gibt, das nicht bereit ist, geschätzte drei Minuten Zeiteinsparung im Stau gegen ein Adelsprädikat wie den Welterbetitel einzutauschen. Vor allem, weil sie ja dann trotzdem noch zwölf Minuten im Stau stehen.
Sie haben bewiesen, nicht zuletzt durch Ihre enorme Spendenbereitschaft, dass in dieser Stadt tatsächlich Welterben der Herzen leben, allerdings anders, als dies Herr Mücke meinte.
Die größte Auszeichnung für uns alle und zugleich einer der für mich persönlich ergreifendsten Momente ist eine Begebenheit die Michael Kaiser und Ralf Weber aus Quebec erzählten: Als sie das Rederecht erhielten und vor den Delegierten der UNESCO-Konferenz die Möglichkeit bekamen, um ein weiteres Jahr auf der roten Liste zu bitten, und berichteten, welche ungeheuren Anstrengungen seitens der Bürgerschaft hier in Dresden unternommen wurden, standen die Delegierten der UNESCO am Ende des Vortrages spontan auf und applaudierten minutenlang. Ein Vorgang, den es so noch nicht gegeben hat.
Lassen Sie mich in diesem Sinne schließen und Sie bitten: Bleiben Sie aktiv im Rahmen unserer Bürgerbewegungen!
Wir kämpfen hier nicht gegen ein Bauwerk, sondern wir setzten uns ein für die Bewahrung dieses einmaligen historisch gewachsenen Natur-, Landschafts- und Erholungsraumes.
Wir setzten uns ein für den Erhalt – oder besser die Wiedererlangung – der kulturellen Identität unserer Stadt, wir setzten uns ein, für den Erhalt des Erbes unserer Vorfahren.
Wir setzten uns vor allem ein für diese unsere Stadt Dresden, die, wenn sie auch vieles nicht ist, eines aber ganz gewiss: eine mit einem besonderen künstlerischen Genius Loci gesegnete Stadt.