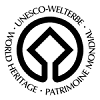Redebeitrag von
Klaus Gaber
zum Neujahrsempfang
der Welterbebewegung Dresden
Im antiken Griechenland schufen die Bürger Athens die Grundlagen europäischer Zivilisation und Kultur, Wissenschaft und demokratischer Regierungsform. Ihre künstlerischen und baulichen Schöpfungen galten damals als Weltwunder und sind z.T. noch heute Weltkulturerbe.
In der Nachbarschaft Athens, in der Landschaft Böotien, lebte ein Volksstamm, an dem diese kulturelle und zivilisatorische Entwicklung offensichtlich völlig vorbei ging. Dessen Ruf bei den Athenern war entsprechend schlecht. Und so wurde der Begriff „Böotier“ bis in unsere Tage ein Synonym für denkfaule und kulturlose Zeitgenossen.
Wenn heute in Regensburg oder im Rheintal darüber gestritten wird, ob geplante Brücken mit dem Welterbe vereinbar sind, dann liest man schon mal in der überregionalen Presse die Warnung vor einem „zweiten Dresden“.
Wird Dresden zum neuzeitlichen Synonym für Kulturlosigkeit?
Ich werde an den verschiedensten Orten (selbst in einer Schweizer Berghütte) angesprochen, von Bekannten und völlig Fremden: Wie könnt Ihr den Welterbetitel so leichtfertig aus Spiel setzten, um den sich andere Orte vergeblich bemühen – ohne überzeugende Notwendigkeit? Und ich muss antworten: Ich verstehe das auch nicht.
Der kulturelle Ruf Dresdens steht auf dem Spiel und die Folgen werden böse sein.
Bei vielen von uns macht sich Trauer, Scham und Resignation breit, angesichts der Verhältnisse in unserer Stadt. Von manchem höre ich die Frage, ob man nicht wieder die Koffer packen sollte, für die Ausreise in eine kulturelle Emigration. Doch wir sind hier nicht zusammengekommen um zu klagen. Wir sagen wie vor 20 Jahren: Wir bleiben hier – als Repräsentanten des Welterbegedankens, als kulturelles Gewissen unserer Stadt.
Dafür gibt es gute Gründe:
Noch steht die Brücke nicht und der Welterbetitel ist nicht aberkannt.
Es gibt eine technische und finanzielle Alternative zur Brücke: einen Elbtunnel. Michael Kaiser hat eine realistische Möglichkeit einer welterbeverträglichen Lösung soeben sehr klar umrissen und die notwendigen Schritte genannt.
Noch ist es nicht zu spät.
Wir fordern von der Oberbürgermeisterin und dem Stadtrat die konsequente Umsetzung der Stadtratsbeschlüsse, alles zu tun, um den Welterbetitel zu erhalten.
Unsere Stadt ist gespalten. Bis in Freundeskreise und Familien hinein geht dieser Riss. Viele beklagen das und wollen diese Kluft zukleistern, auch wohlmeinende Politiker. Ich halte das für falsch. In dieser z.T. unversöhnlichen Auseinandersetzung wird deutlich, was in unserer Stadt im Argen liegt, werden die widersprüchlichen Lebenshaltungen und politischen Ziele unserer städtischen Gesellschaft sichtbar.
Eine „Heilung“ ist nur möglich, wenn die Gegensätze und Positionen, welche die Entwicklung der Stadt – nicht nur in der Welterbe-Frage – stark belasten, klar benannt, politisch thematisiert und diskutiert werden.
Auf der einen Seite ist ein kurzfristiges Nützlichkeitsdenken bestimmend, das die Vorhaben und Ziele nach ihrer materiellen Verwertbarkeit klassifiziert und fördert. Die politische Entscheidungsfrage des „Mannes von der Strasse“ lautet: „Was kann ich mir dafür kaufen?“ Der Glaube an ein ewiges materielles Wachstum bei gesteigertem Anspruchsdenken verkleistert die Sicht darauf, auf wessen Kosten und wie lange das noch möglich ist.
Auf der anderen Seite werden die Erfordernisse einer nachhaltigen Lebensweise immer deutlicher. Die aktuellen Finanz- und Rohstoffkrisen führen die Markt-, Globalisierungs- und Wachstumsgläubigkeit ad absurdum.
Verantwortung für die Zukunft unserer und nachfolgender Generationen, hier und weltweit, ist keine unverbindliche Forderung in Sonntagsreden mehr, sondern wird zu einer knallharten, auch wirtschaftlichen, Überlebensbedingung für unseren Planeten. Eine Harmonisierung unserer Lebens- und Produktionsweise wird nur gelingen im Einklang mit einem neuen Wertebewusstsein, mit einem kulturvollen Umgang mit Mensch und Natur.
Der Mangel an wert- und kulturorientierten bürgerlichen Traditionen wird uns besonders hier im Osten als eine Folge langjähriger ideologischer Fremdbestimmung schmerzhaft bewusst. Im Gefolge dieser grundsätzlichen Defizite beklagen wir eine Unkultur im politischen Umgang und in der Austragung von Konflikten, die politische Instrumentalisierung der Rechtsinstitutionen, eine Machtorientierung statt eines Wertebewusstseins der Politiker, Lobbyismus statt Bürgerbeteiligung, Resignation und Desinteresse statt bürgerschaftlichem Gestaltungsanspruch, eine Hof-Kultur statt einer Bürgerkultur.
Die Brückendiskussion stellt uns vor entscheidende Fragen zur künftigen Stadtentwicklung: Eine autogerechte Stadt in Zeiten der Ressourcenverknappung und des Klimawandels oder ein Vorrang für die nachhaltigen Ressourcen Kultur, Natur und lebenswerte Umwelt. Die Brücke führt zurück in eine überholte Ideologie des Wachstumswahns und der kurzfristigen Renditen, der beschleunigten Ausbeutung unseres Planeten.
Umkehr
in einer Sackgasse
ist Fortschritt
Aber mit dem Fall solcher Ideologien fallen über kurz oder lang auch deren Monumente. Der Palast der Republik ist ein jüngstes Beispiel. Das lässt uns hoffen. Besser ist es allerdings, solche rückwärtsgewandten baulichen Symbole erst gar nicht zu errichten. Wir dürfen uns mit dieser Brücke und der Zerstörung des Welterbes, auch langfristig, nicht abfinden.
Und ein weiterer Grund, der uns Kraft und Motivation gibt, in unseren Bemühungen um das Welterbe nicht nachzulassen, ist die Liebe zu unserer Stadt. Nur was man liebt, kann man mit allen Kräften verteidigen. Wir schützen dieses kostbare Erbe nicht nur für uns. Wir haben es von unseren Vorfahren erhalten, um es unseren Nachfahren unzerstört zu übergeben, als Welterbe in globaler Verantwortung.
Wir wollen für die Welterbeidee das kulturelle Gewissen unserer Stadt bleiben.
Deshalb müssen wir wachsam bleiben, denn nicht nur der Brückenbau gefährdet das Welterbe. Es gibt Kräfte, die den Welterbetitel liebend gern los würden, weil sie sich unter den Augen der Weltkulturgemeinschaft „nicht mehr als Herr im eigenen Hause fühlen“, d.h. nicht mehr nach eigenen Verwertungsinteressen mit dieser Stadtlandschaft umspringen können.
Was können, was müssen wir tun?
Wir müssen weiter zusammenstehen. Die Welterbebewegung hat einen erstaunlichen Rückhalt in der Bevölkerung. Der heutige Abend belegt es einmal mehr. Dennoch müssen wir den Welterbegedanken weiter verbreiten, unsere Mitbürger dafür sensibilisieren, uns nicht von gegnerischen Kampagnen unterkriegen lassen. Deshalb müssen wir unsere bisherigen Organisations- und Kommunikationsstrukturen erhalten und stärken.
Wir wollen der kulturellen Welt, vor allem der UNESCO zeigen, dass Dresden nicht identisch mit jenen ist, die diese hohe Auszeichnung als Welterbegebiet missachten und aufs Spiel setzen. Wir müssen weiterhin national und international als seriöse und fachkompetente Ansprechpartner erkennbar sein und die vorhandenen Kontakte pflegen. Insbesondere ist der gute Kontakt zur UNESCO weiter auszubauen und der Weltorganisation zu vermitteln, dass die kulturell engagierte Bürgerschaft unserer Stadt zur UNESCO und ihrem Anliegen steht. Dies gilt es auch in vielfältiger Weise in unserer Stadt zu zeigen.
Wir brauchen belastbare Organisationsformen, um die Wächterfunktion für das Welterbegebiet (World Heritage Watch) zu erfüllen, um alle Ansätze der Zerstörung in diesem Kulturlandschaftsraum zu unterbinden. Wir brauchen eine stärkere Vertretung in den politischen Institutionen der Stadt, auch durch eigene Vertreter der Welterbebewegung.
Das Superwahljahr 2009 fordert von jedem politische Entscheidungen. In Europa, in der Bundesrepublik, dem Land Sachsen und in unserer Kommune steht auch der Umgang mit Kultur und Welterbe zur Wahl. Darauf sollten wir Einfluss nehmen.
Wir werden weiter machen. Nicht jeder von uns kann jeden Tag auf der Strasse stehen. Aber wir können an jedem Tag in vielfältiger Weise Kultur leben und einfordern.
Lasst uns dafür sorgen, dass der Name Dresden nicht mit Provinzialität und Kulturlosigkeit in Verbindung gebracht und zum sprachlichen Synonym dafür wird, wie es einst den ungehobelten Nachbarn der Kulturstadt Athen, den Böotiern, widerfuhr.