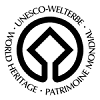Sichert das Ende aller Geschichte
der sächsischen Union ewige Macht?
fragt Johannes Hellmich
Tapfer lacht der Mann in die Kameras. Er müht sich redlich und verstecken geht nicht. Immer öfter posiert er für bessere Stimmung unter seinen Landsleuten. Verständnis haben und den Menschen zuhören; darin ist er mindestens so gut wie Bürgerpräsident Köhler. Es sind Nuancen, die den Unterschied ausmachen und Unsicherheit verraten. Im Grunde bleibt er ein Mann der zweiten Reihe: Sich hocharbeiten, geräuschlos, loyal bis an das Zentrum provinzieller Macht heran. Verlässlichkeit ausstrahlen. So hätte es noch lange bleiben können. Ausgerechnet das Versagen seines Hauses katapultiert den Finanzminister ganz nach oben. Sein Mentor hat aufgegeben und lässt den Getreuen allein zurück. Über Nacht muss der jetzt diese riesige Last schultern, muss selbst jene Zuversicht vermitteln, die das ostdeutsche Musterländle durch schwere Zeiten führen soll. Der sympathische, etwas scheue Stanislaw Tillich ist plötzlich sächsischer Ministerpräsident.
Sein Einstieg steht freilich unter keinem guten Stern: das Landesbankdesaster wird Vorbote einer weltweiten Implosion der Finanzstrukturen. Dennoch schreiben die sächsischen Blätter für den Sorben eine Art Neuanfang herbei. Manche verkünden gar das Ende der Nachwendezeit (merkwürdig genug; hat 1964 noch jemand von Nachkriegszeit gesprochen?). Die Aufregung über den Notverkauf der Bank legt sich auf wunderbare Weise. Lange Zeit hört man nichts von dem Neuen.
Dann der Paukenschlag. Öffentliche Erregung zunächst über Tillichs frühere Anpassung an das SED-Regime. Der Bloßgestellte reagiert beleidigt. Er wähnt sich als Opfer einer Kampagne. Seine Kariere in der CDU-Ost wird zur Via Dolorosa umgedeutet. Den staunenden Ostdeutschen erklärt Tillich noch einmal die DDR. Erneut muss König Kurt eingreifen, um Schlimmeres zu verhindern. Wortgewaltig hilft er seinem Nachfolger aus der Bredouille, wenn auch mit den gleichen verlogenen Argumenten. Patriotische Leserbriefe füllen daraufhin wochenlang die sächsische Presse. Da ist sie wieder, jene Bunkermentalität, die Partei und Volk in schwerer Stunde zusammenrücken lässt.
Vielleicht hat Tillich als Staatsmann mehr Glück. Er wagt sich auf internationales Parkett, fast rutscht er aus: Auf einem glamourösen Ball in der Landeshauptstadt überreicht er seinem russischen Amtskollegen und kaukasischen Helden einen Dankesorden. Harald Schmidt wird den Fauxpas mit beißender Häme bundesweit bekanntmachen. Dem Image des bescheiden gebliebenen Politarbeiters Tillich tut die Karnevaleske glücklicherweise keinen Abbruch. Er schweigt. Die richtige Antwort gibt er auf dem Parteitag der sächsischen Union im Januar. Hier darf er Führungsstärke beweisen: Die CDU-Cousins Kolbe und Winkler sind wegen der Schwarztank-Affäre außer Rand und Band. Auch Haiderverehrer Schimpff lässt sich kaum noch kontrollieren. Tillich wird strahlender Sieger des Treffens. Seine Parteifreunde schicken ihn mit fast 99 Prozent Zustimmung als Spitzenkandidat in die Landtagswahl, um der Union für weitere Jahre die Vorherrschaft in Sachsen zu sichern. Für den Mann mit dem treuherzigen Blick ein Selbstläufer. Man redet von Alleinregierung und rechnet intern mit erstarkten Freidemokraten. Zu befürchten ist von denen ohnehin nichts. Aber eben auch nichts zu erwarten.
Einige Kilometer nördlicher Richtung stellt mit Qimonda ein Leuchtturm des christdemokratischen Wirtschaftswunders Ost den Signalbetrieb vorerst ein.
Ende der Geschichte
Die Inszenierung sächsischer Landespolitik als Realsatire wird vermutlich auch in der nächsten Spielzeit fortgesetzt. Die Besetzung der Hauptrollen ist ohne Belang. Selbst der muffige Geruch des Theaters wird bleiben. Das Bühnenbild ist furchtbar genug: barocker Kitsch und Betonwut sorgen für Platzangst. Zuständig für ein wenig Klamauk ist offenbar die Junge Union. Unvergesslich immerhin, wie sie im letzten Jahr mit selbstgefertigten Fledermauskostümen die Aufmerksamkeit einer Welterbekundgebung zu provozieren suchte. Ob die jungen Wilden aus meist gutem Hause davon später ihren Kindern berichten? Auch der jüngste Coup der Dresdner Union verrät Sinn für Überraschendes; die Präsentation des farbigen DJs Abdulaye beim Kampf ums Rathaus. Wird die Theaterzeitung titeln: Obama-Effekt – Union bezwingt endlich die Neustadt? Das wäre ein Ansatz. Mehr dramaturgische Einfälle sind den Autoren zu wünschen! Das unerschöpfliche Thema liegt auf der Hand: die Kulturrevolution der CDU in Sachsen. Wäre das nicht ein schönes Bild: Ein dicklicher Altstudent mit Nickelbrille würde entblößten, kriechenden Kunst-Komparsen mit blutigen Striemen das Wort Blockadeelite einpeitschen; während Sisyphos Rohwer auf einem steingrauen Hüpfball über die Elbwiesen springt. Nach einem furiosen Finale steckt die einzig übriggebliebene Dame in Schwarz jedem Gast mit feierlichem Ernst eine weiße Rose an und fährt davon mit dem Sohn des Sonnengottes Helios (gespielt von Werner Patzelt). Don’t cry for me Argentinia. Aber – nichts davon passiert. Das traurige Heimatstück erzeugt als Endlosschleife nur immer wieder Leere; es betäubt den Verstand und stumpft ab, so dass wir die eigentliche Handlung nicht mehr erkennen. Mancher Zuschauer mag unwillkürlich an Fukuyamas These vom Ende der Geschichte denken. In Sachsen hat man ihren Beweis erbracht.
Anpassung als Überlebensfrage
Schieben wir also die Theaterkulissen beiseite. Treten wir aus der Dumpfheit ins Freie; Hoffnung wird der Aufmerksame überall finden. Lernen wir wieder, Fragen zu stellen. Warum nicht auch zu dem Stück, das wir so gut zu kennen glauben. Wie lange mag so ein Aufbau sozialer Marktwirtschaft dauern? Oder: Sind wir noch immer Teil eines geheimnisvollen Transformationsprozesses? Stoff genug zum Nachdenken. Die Lageberichte sind widersprüchlich. Allen gemeinsam scheint indes eines: Die eingeforderte Bereitschaft zur Veränderung. Flexibilität lautet denn auch einer der prägendsten Begriffe dieser Zeit. Irgendwie ein Herrschaftswort, das sich trotz häufigen Gebrauchs kaum abnutzt. Aber was steckt dahinter? Wettlauf fällt mir ein; vielleicht ein Rennen ohne Ziel, die Jagd, die Grundvoraussetzung des Überlebens. Zur Anpassung gehört Schnelligkeit. Schnelligkeit verlangt Beschleunigung. Zeit zum Nachdenken kann und soll nicht sein. Reflexion wird unnötig, weil das Gestern schon nicht mehr auffindbar ist. Flexibilität ist ein Wort der Entgrenzung. Auch Verzicht steckt darin. Dieser Verzicht wird belohnt. Das suggeriert derjenige, der Flexibilität fordert. Aber er legt sich nicht fest. Biegsam sind auch die Fordernden. In der Wirtschaft, aber mehr noch in der Politik. Die sächsische Union ist ein schönes Beispiel dafür. Trotz ihrer Dominanz bleibt sie inhaltlich (abgesehen vom Bekenntnis zu ihren Klassikern Erhard und Adenauer und ein bisschen friedlicher Revolution) schwer fassbar. Das scheint ein Vorteil gegenüber der Geradlinigkeit sozialistischer Parolen zu sein.
Wird sich denn niemals etwas ändern?, fragst du. Ich habe zwei Antworten. Die erste ist schnell gesagt. Sie mag dir gefallen oder nicht: Ja sicher, irgendwann bestimmt, aber im Moment … Die Leute wollen, was sie gewöhnt sind, gerade in schwierigen Zeiten. Das Problem ist die Schwäche der SPD. Und so weiter. Die Begründungen kennst du alle selbst. Die andere Antwort ist etwas schwieriger und wenig schmeichelhaft für uns. Ich kann sie aber nicht anders geben:
Der ungeschriebene Gesellschaftsvertrag in Sachsen beruht auf einer monströsen Erpressung, deren Urheber nach der Wende die eigentliche Vox Populi wurde: „Kommt die D-Mark, bleiben wir, kommt sie nicht, geh’n wir zu ihr!“ Die Forderung nach dem Erbteil aber wurde zur Patientenverfügung; die Einwilligung in ein künstliches Wachkoma; hoch dosiert versorgt mit Solidarleistungen. Auf dieser Intensivstation befinden wir uns noch immer, längst herausgefallen aus Raum und Zeit. Frage dich selbst, was sich in zehn, in fünfzehn Jahren verändert hat. Gemessen an gesellschaftlicher Entwicklung früherer Dekaden schrumpft diese Zeit zusammen auf 100 DM Begrüßungsgeld für eine freie Welt, die für viele Terra incognita bleibt. Die Vormundschaft des Realsozialismus ist weitergegeben worden. Diesmal an die Partei mit dem C.
Die sogenannte Angleichung der Lebensverhältnisse (an vornehmlich süddeutsche Standards) darf denn auch als das Treueversprechen zwischen uns und der Partei gelten. Der Bund, den eine Allianz für Deutschland mit dem Wahlvolk geschlossen hat, ist auf Ewigkeit angelegt. Die Verheißung der Angleichung ist zugleich Legitimation ihrer Herrschaft. Eine Einlösung ist im Zweifelsfall erst in ferner Zukunft fällig. Das schadet der Vision nicht. Sie hat das Denken und Handeln vieler Sachsen völlig durchdrungen, obschon der „Abstand“ zu den alten Ländern unverändert geblieben ist. Nicht nur in ökonomischer Hinsicht. Auch ungleich höhere Arbeitslosigkeit trotz aller statistischen Raffinesse, soziale Entwürdigung auf verschiedenen Stufen des Abstiegs können die Hoffnung nicht trüben, die Aufholjagd doch noch zu gewinnen. Nebenbei reproduziert die gemeinsame Anstrengung noch mehr Zusammengehörigkeit.
Potemkinsche Dörfer
Du wirst längst bemerkt haben, dass die neuen Herren viel schlauer als die alten sind. Sie verstehen es, ihre Gedanken gut zu verbergen, wenn sie etwas sagen. Ihre Worte lassen Raum für Auslegungen. Oft ist die eigentliche Absicht das genaue Gegenteil des Wortsinns. Nicht selten führen sie auf eine falsche Fährte. Wichtig wird dann, was genau nicht gesagt wird. So etwas nennt man Euphemismus. In der Kunst der geschickten Wortwahl sind sie unübertroffen. Darin liegt ein großer Teil ihrer Macht. Aber nicht immer gelingt das. Ich will dir ein Beispiel dafür nennen. Vor einigen Tagen hat Bundespräsident Horst Köhler die Lausitz besucht, um sich über eine Region im demographischen Wandel zu informieren. So der offizielle Sprachgebrauch, den die Medien übernommen haben. Gemeinsam mit Tillich traf er auf seiner Fahrt durch Potemkinsche Dörfer auf Menschen, die der Strukturkrise trotzen. Die beiden besten Zuhörer der Republik waren beeindruckt vom Widerstandswillen der daheim gebliebenen Alten und Schwachen und lobten sie wie Kleinkinder. Was die Formulierung vom demographischen Wandel verdeckt, ist etwas sehr Konkretes. Verödung und Überalterung ganzer Landstriche in den neuen Ländern werden so als ein Prozess naturgesetzlicher Unabwendbarkeit beschrieben; in Wahrheit sind sie zuallererst reale Folge politischen Versagens. Für die Rahmenbedingungen des Gedeihens der Lausitzer Region zeichnet die sächsische Union verantwortlich. Nicht die DDR. Und nicht die Finanzkrise. Christdemokratische Familienpolitik hat dazu beigetragen, dass die massive Abwanderung junger Menschen und ganzer Familien seit der Wende nie aufgehört hat. Mancher wird sich noch an die groteske Situation erinnern, als im Jahr 2000 das Arbeitsamt Bautzen arbeitslosen Fachkräften die Übersiedlung nach Bayern mit einem Wegegeld erleichterte. Die Union redet dennoch gern von der Erfolgsgeschichte der sozialen Marktwirtschaft. Hast du bemerkt, dass es nach fast 20 Jahren noch kaum Arbeitnehmervertretungen in klein- und mittelständischen Unternehmen gibt und dass Arbeitgeber sich nicht sonderlich um eine Sozialpartnerschaft bekümmern? Lange nach dem Chaos der Nachwendezeit werden Menschen in den Betrieben noch immer niedergehalten und nach Belieben hinausgeworfen; Rechtsbrüche aller Art machen Geschäftsführern keine Kopfschmerzen. Es ist der reale Teil jener Wertegemeinschaft, die die Union so gern im Mund führt.
Der weiße Wal
Aber was genau hat es auf sich mit dieser Wertegemeinschaft? Ziehen wir alle sozialen, ökonomischen und demokratischen Glaubensbekenntnisse ab, die sich fast gleichlautend auch in den Programmen der politischen Konkurrenz finden, bleibt als Alleinstellungsmerkmal vor allem eine gemeinsame Klammer: Der irrationale Hass auf alles, was als links verdächtigt wird. Dieser Antikommunismus mit seinen tausend Spielarten ist die hysterische Jagd der Union auf den weißen Wal, die jeden vernünftigen Gesellschaftsdiskurs unmöglich macht – eingeschlossen die Verkehrspolitik. In seiner provinziellen Ausformung wird er zugleich Antiintellektualismus. Im einstigen Hoffnungsträger der CDU-Ost, Arnold Vaatz, mag man unschwer den von Rachsucht besessenen Kapitän Ahab erkennen, der im Ringen mit dem teuflischen Ungetüm einst sein Bein verlor. Alle an Bord der sächsischen Pequod werden eingeschworen auf die Verfolgung der Bestie. Ein politisches Borderline-Syndrom bestimmt die Route der Geisterfahrt. Es ist knapp zwei Jahre her, dass Vaatz in einem CDU-Journal Bürger dieser Stadt verunglimpft hat, die es wagten, ein überdimensioniertes Verkehrsprojekt noch einmal zu hinterfragen. Markiert dieses Pamphlet, für das die inhaltliche Zustimmung weiter Teile der sächsischen Union als sicher gelten darf und das im weiteren Verlauf der Parteiaustritte vom Kreisvorsitzenden Rohwer indirekt gebilligt wurde, den Point of no Return? Dafür spricht einiges. Es war nicht nur der Moment, in dem letzte vernünftige Argumente auf dem Kollisionskurs mit der (vermeintlich feindlichen) UNESCO über Bord geworfen wurden. Zum ersten Mal auch trat für die Öffentlichkeit eine latente Haltung in der Union zu zentralen Fragen der Demokratie, Kultur und Ökologie überraschend klar zu Tage. Für Herrn Vaatz jedenfalls blieb die Angelegenheit offenbar ohne Folgen. Er wird für die CDU wohl weitere vier Jahre dieses Land im Bundestag vertreten.
Wenn man so will, sorgt er auf bescheidenem Niveau noch immer für Kurzweil. Das Gezerre um die Gedenkfeiern zum 13. Februar bot günstige Gelegenheit. Der oberste Walfänger wusste der Linken die Schuld am braunen Aufmarsch zuzuweisen.
Einer, für den die Dresdner Tragödie 1945 Rettung bedeutete, weil er im Chaos der Bombardements dem Transport in den sicheren Tod entkommen konnte, war der Rabbinersohn Victor Klemperer. Wo würde er die Ursachen für den Marsch der neonazistischen Kolonnen durch Dresden in diesen Tagen sehen? Würde der politisch denkende Mensch Klemperer, der 1945 in die KPD eintrat, fragen, wer Hitler als Reichskanzler an die Macht brachte? Würde der Philologe Klemperer darauf hinweisen, dass das, was sich heute so unverfänglich die Mitte nennt, damals Zentrum hieß? Würde der rassisch Verfolgte die Parteien nennen, die für das Ermächtigungsgesetz stimmten und damit das Tor zur Hölle ganz aufstießen? Linke gehörten nicht dazu. Aber nicht wenige Namen von Abgeordneten, die am 23. März 1933 mit Ja votierten, tauchten nach Kriegsende in eben jener Partei auf, die auch für Herrn Vaatz politische Heimat ist. Der geschmeidige oder treffender: flexible Umgang der Union mit historischen und politischen Zusammenhängen bleibt jedoch nicht auf ihre Protagonisten wie Arnold Vaatz beschränkt. Er ist Konsens einer Wertegemeinschaft.
Ihr seid das Salz der Erde.
Wenn nun das Salz nicht mehr salzt,
womit soll man salzen?
Es ist zu nichts mehr nütze,
als dass man es wegschüttet
und lässt es von den Leuten zertreten.
Matthäus 5, 13 (aus der Bergpredigt)
Und dennoch: Eine gemäßigte konservative Kraft ist unverzichtbar für ein pluralistisches demokratisches Gefüge. Wenn christliches Selbstverständnis ihr Handeln bestimmt, kann sie sogar so etwas wie das Salz für diese Gesellschaft sein. Eine Rückbesinnung auf die eigentlichen Stärken einer verlässlichen Werteorientierung, Subsidiaritätsdenken und Schutz eines bürgerlichen Individualismus in Verantwortung wäre ihr zu wünschen. Kompromissfähigkeit und ein konstruktiver Umgang mit Kritik können neu erlernt werden. Nicht wenige Welterbefreunde hoffen noch immer auf die Umkehr zu einer bürgerlichen Politik, der sie sich verbunden fühlen können. Das Aufeinanderzugehen im Welterbekonflikt wäre ein guter Anfang.
Das Bild vom Salz der Erde bleibt noch in einer anderen Hinsicht interessant. Es beschreibt ein Spannungsverhältnis von Mehrheiten zu Minderheiten. Beide brauchen einander, solange das Salz seine Kraft behält. Ein Zuviel macht das Essen ungenießbar. Das passiert dann, wenn Machtinteressen von Parteien dem Gemeinwohl entgegenstehen. Wird das Salz unbrauchbar, schütten es die Leute weg, heißt es im Gleichnis. Das wird nicht gehen, wirst du vielleicht sagen; es gibt ja sonst keins. Und wenn doch? Vielleicht sieht es nur etwas anders aus – grün zum Beispiel.