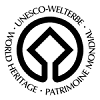ein Beitrag von
Johannes Hellmich
Difficile est
satiram non scribere
Die Amerikaner nennen Politiker, die keine wichtigen Entscheidungen mehr treffen, etwas mitleidig Lame Duck. Dresdens Oberbürgermeisterin Helma Orosz ist der Einzug ins politische Entenhausen bereits nach einem Jahr gelungen. Hoffnungslos überfordert von einer rot-grünen Opposition im Stadtrat, schwankt sie zwischen Aktionismus, Realitätsverweigerung und Anbiederung. Manches mag sie dabei an frühere Erfahrungen in sozialistischen Kindereinrichtungen erinnern. Vertraute Instrumente wie Lob und Liebesentzug aber versagen in ihrem jetzigen Wirkungskreis. Die angekündigten neuen Kapitel des Dresdner Erfolgsromans, geschrieben von den Ghostwritern der Staatskanzlei, werden schon jetzt zur Anleitung zum Unglücklichsein. Auch wenn sich die Bürgermeisterin nach diesem Drehbuch als tragische Heldin weiter von Peinlichkeit zu Peinlichkeit hangelt – die alleinige Verantwortung dafür trägt sie nicht.
Orosz’ hastiges Statement in Sevilla war kläglicher Schwanengesang eines Scheiterns auf Raten. Vorausgegangen waren diplomatische Ungeheuerlichkeiten, die der gewöhnliche Welterbefreund nicht für möglich hielt. Die Einflussnahme auch einiger Dresdner Bundestagsabgeordneter auf Komiteemitglieder mit dem Ziel, den klaren Beschluss von Quebec aus dem Jahr 2008 durch das Komitee selbst kassieren zu lassen und damit die Glaubwürdigkeit der Welterbeidee zu verspielen, hat kürzlich einen interessanten Abschluss gefunden. Der ägyptische Vorstoß, Dresden ein weiteres Jahr auf der Roten Liste zu belassen, erscheint vor dem Hintergrund von Interventionsversuchen selbst des Auswärtigen Amtes besonders prekär: Ägyptens (wegen antiisraelischer Äußerungen) umstrittener Kulturminister war aussichtsreicher Anwärter auf den neu zu besetzenden Chefsessel der UNESCO. In geheimer Abstimmung scheiterte der ägyptische Antrag zum Dresdner Welterbe, vornehmlich, wie es hieß, am Widerstand der Amerikaner, Spaniens und Israels. In diesem Zusammenhang darf auch der Zwischenstopp des amerikanischen Präsidenten Anfang Juni in Dresden als Versuch gewertet werden, ein für Dresden günstiges Klima in Sevilla zu schaffen. Allein; die für den Freistaat 13 Millionen Euro teure PR-Aktion, deren einziger Sinn in die Welt übertragene schöne Bilder und ein wenig Publicity waren, verpuffte wirkungslos. Umsonst auch die Gefälligkeit der Ägypter: Der aussichtsreiche Faruk Husni verlor in einer Stichwahl um den Job des Generaldirektors überraschend gegen die Bulgarin Irina Bukowa.
Kaum aus Spanien zurück, kündigte Orosz vollmundig einen neuen Welterbeantrag an, offensichtlich ohne jegliche Kenntnis der dafür notwendigen Voraussetzungen. Einmal mehr offenbarte sie, dass ihr der Welterbegedanke, über den sie die UNESCO belehren wollte, bis heute fremd geblieben ist; trotz eigenen Engagements für den Bad Muskauer Förderverein. Ein neuer Welterbeantrag scheint inzwischen erledigt. Zuletzt war aus dem Rathaus die zynisch-überhebliche Einschätzung zu hören, man müsse die Aberkennung nun erst einmal sacken lassen. Probleme hat Orosz ohnehin genug. In der Morgenpost wird, im Gegensatz zu Peter Ufers OB-Fanzine aus gleichem Verlagshaus, immer offener über die Befähigung der Dresdner Verwaltungsspitze und ihrer Umgebung spekuliert. Wer aber steht ihr in einer langen Reihe von Missgriffen zur Seite?
Auf der Suche nach Schuldigen an der verfahrenen Situation im Stadtrat hat die Sächsische Zeitung kürzlich den Fokus auf Orosz’ Berater gerichtet. Unklar bleibt, in welchem Umfang und mit welchem Erfolg diese Beratungen tatsächlich das Handeln der Oberbürgermeisterin beeinflussen, doch fallen zwei Personalien besonders auf. Gleichsam als Pendant zu Wirtschaftsbürgermeister Hilbert, der sich einst mit dem zum Absturz gebrachten Brandenburger Cargo-Lifter seine Sporen verdiente, wird als Wirtschaftsberater der Druckerei-Chef Thomas Bohn genannt; ein branchenweit für Niedriglöhne bekannter Unternehmer, der Orosz 2008 dank seines Equipments in einer beispiellosen Materialschlacht beim OB-Wahlkampf tatkräftig unterstützte. Dass er zur gleichen Zeit 43 bereits unterzeichnete Ausbildungsverträge kurzerhand kündige, als die IHK es wagte, eine berufsübliche Ausbildungsvergütung zu fordern, scheint in der Union niemanden ernsthaft zu stören.
Mit Kommunikationsprofi Michael Sagurna begegnet uns ein weiterer alter Bekannter, der die Linie der Stadtverwaltung in Sachen Welterbe und Waldschlösschenbrücke noch immer mitbestimmt. Biedenkopfs getreuer Pressesprecher schaffte unter Milbradt ein Comeback als Chef der Staatskanzlei. Retten konnte Sagurna den angeschlagenen Milbradt allerdings nicht mehr. Interessant aber ist, wie er zwischenzeitlich ein neues Lied der Demokratie anstimmte. Während Sagurna in Staatsdiensten kompromisslos auf der Respektierung des Bürgerentscheids von 2005 bestand, als geriete sonst der Rechtsstaat ins Wanken, nahm er als PR-Berater des Molkereigiganten Müller in Leppersdorf den Bürgerwillen nicht ganz so ernst. Trotz des eindeutigen Votums der Anwohner in einem Bürgerentscheid gegen die Müllverbrennungsanlage betrachtete Sagurna das Scheitern Müllers in seinem neuen Job eher als Kommunikationsproblem. Ohne dass ein Baurecht für das Heizkraftwerk vorlag, bereitete seine Medienagentur mit einer Informationszeitung den Boden für einen neuen Anlauf der Molkerei zur Realisierung des Heizkraftwerkes. Müller-Vertreter Gumpp wird im Herbst 2007 mit den Worten zitiert: „Wir kämpfen solange, bis wir tot sind oder bis das Kraftwerk steht.“ Das scheint, nebenbei, leicht abgewandelt auch die Marschrichtung der Union für ein anderes Bauwerk zu sein.
Reicht es, bei Sagurna auf Professionalität zu verweisen? Einige Wochen später wird er im Dresdner Landtag erneut auf die eindeutige Mehrheit der Bürgerschaft für die Elbquerung pochen und von gleich drei Brücken als Zielstellung sprechen: „eine über die Elbe, eine über den Graben zwischen der Dresdner Bürgerschaft und eine zu den Entscheidern bei der UNESCO“. Er gehört neben Biedenkopf, Feßenmayr und Vogel zu jenem Team, dass im darauffolgenden Frühjahr 2008 nach Paris fährt, um Kompromissbereitschaft zu simulieren. Die sachliche, klare Haltung des Welterbezentrums zur Präferenz der Tunnelalternative dürften dem Medienprofi die Augenwischerei der eigenen Mission schnell klar gemacht haben. Doch offenbar genügte ihm da schon die Durchsetzung nur noch einer Brücke.
Dass Land und Kommune Vakanzen für ihr Personaltableau mit ansässigen Politikern wechselseitig auffüllen, ist naheliegend. Und doch hat die Patronage seitens der Landesregierung für Dresden auch in diesem Bereich fatale Folgen. Selbst die Personalie Orosz ist Ergebnis einer Findungskommission des sächsischen Ministerpräsidenten Milbradt. Mit dabei war auch jener Politologe Werner Patzelt, der als Experte regelmäßig öffentlich den Lagebericht ausgibt. Die parteipolitisch gefärbte personelle Verflechtung von Verantwortungsebenen und öffentlicher Kommunikation haben in fast zwanzig Jahren erheblich zur Ohnmacht kommunaler Selbstbestimmung beigetragen. Mit seiner Förderbeschränkung für die Waldschlösschenbrücke schlug Kajo Schommer einen der entscheidenden Pflöcke ein. Erstaunlich genug wurde die Demontage der Dresdner Eigenständigkeit vom Wähler immer wieder belohnt. Der jüngste Wahlerfolg von Ex-Umweltminister Arnold Vaatz, der wie kein anderer für die Degeneration eines aufgeklärten Bürgerrechtsdenkens zur antidemokratischen Demagogie steht, ist kein Ausrutscher, sondern symptomatisch.
Die vergangenen Land- und Bundestagswahlen haben mit ihrem Ausgang der sächsischen Demokratie für weitere Jahre eine Embryonalstellung vorgegeben. Schmerz und Enttäuschung sind so scheinbar am ehesten zu ertragen. Die tiefe kulturelle Krise einer unbewältigten Nachwendezeit, die am sichtbarsten ausgerechnet in Dresden zutage tritt, lässt sich durch resignierenden Rückzug ins Private nicht lösen. Genauso wenig können Brot und Feuerwerk die leere Seele einer Stadt füllen. In scharfem Kontrast dazu setzte erst Ende August eine Welterbeveranstaltung im Dresdner Rathaus beeindruckende Zeichen der Hoffnung. Daran wollen wir festhalten. Zum aufrechten Gang gibt es letztlich keine Alternative.