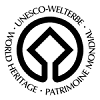von Johannes Hellmich
Hat Elbflorenz auch daher seinen namentlichen Bezug zur toskanischen Metropole, weil den Dresdnern ein italienisches Temperament eigen ist, das als sächsisches Lamento um den Erhalt seiner weiten Flusslandschaft weltberühmt geworden ist? Es scheint, als liebe der Dresdner den lautstarken Protest so sehr, dass der rasche Wechsel der Streitobjekte seine Obsession eher beflügelt und es ihm vielleicht gar nicht so schrecklich ernst damit ist, die Konflikte im Interesse aller zu lösen. Sie sind eben so, die Dresdner; unnötig, sich Gedanken zu machen über ein angeblich vergiftetes Klima, schwere politische Grabenkämpfe und eine gespaltene Stadt.
Das wenigstens wollen uns Kommentatoren glauben machen, wenn von den Auseinandersetzungen um den Kulturpalast die Rede ist. Der Streit um E- und U-Musik ist ihnen der Beweis für ein völlig normales Ringen um beste Konzepte wie überall auf der Welt. Cholerisches Aufbrausen der Kontrahenten wird gedeutet als ebenso berechnende wie theatralische Versuche, sich bei einer im Grunde wohlmeinenden Landesregierung Gehör zu verschaffen. Große Operette mit verspätetem Applaus. So sei das. Immer. Wirklich?
Das Welterbe war noch nicht aberkannt, da hatte die Dresdner SPD eine Unterschriftensammlung ins Leben gerufen, die den Willen der Bürgerschaft nach Erhalt des Kulturpalastes als Multifunktionsgebäude bündeln sollte. Der überdimensionierte Umbau drohte aus einer Mehrzweckhalle ein exklusiv an Hochkultur ausgerichtetes Konzerthaus zu machen zugunsten eines ebenso exklusiven Besucherklientels. Wolfgang Hänsch, Architekt des Kulturpalastes, nennt die Umbauentwürfe von Gerkan, Marg und Partner deshalb eine gute Lösung für eine falsch gestellte Aufgabe. Eine Affinität der Sozialdemokraten zur Stadthalle am Altmarkt war bis dahin nicht unbedingt aufgefallen. Trotzdem schien es aussichtsreich, sich im Vorfeld der Kommunalwahlen des vermeintlichen Reizthemas anzunehmen und sich so vom ewigen, scheinbar verlorenen Brückenstreit abzusetzen.
Die Nutzungsvielfalt des Kulturpalastes ist bis heute ein Erfolgsmodell. Noch immer ist er ein herausgehobener Ort Dresdner Aufbauidentität; kann er als einer der wenigen geglückten einheitssozialistischen Versuche gesehen werden, kulturpolitische Vision, architektonischen Anspruch und städtebauliche Gegebenheiten klug zu verbinden. Das macht diese Begegnungsstätte allerdings auch per se zum Ärgernis einer verfehlten postsozialistischen Stadtplanung, die gestalterische Impotenz in gleicher Weise wie ihre Vorgänger durch Ideologie ersetzt und nicht nur in Dresden Urbanität durch Uniformität und Gleichschaltung beseitigt.
Dass Konflikte in Dresden heftiger als anderswo ausgetragen werden, liegt weniger an der Streitlust der Einwohner, sondern vor allem an der hohen Konzentration der Zutaten für diese Auseinandersetzungen: Fördermittelsteuerung oder -verweigerung, ein entmündigter Denkmalschutz, Desinformation über Kosten, vollendete Tatsachen, machtpolitische Profilierungssucht, eingestandene fachliche Inkompetenz (Marx) und künstlicher Handlungsdruck durch Verschleppung notwendiger Sanierungen. Die Albertbrücke lässt grüßen. Für die Union ist diese Vorgehensweise offenbar zum politischen Arbeitsprinzip geworden. Und doch gibt es beim Streit um den „Kulti für alle“ auch einige Unterschiede. Der Frontverlauf blieb gerade hier lange undeutlich; gut und böse, wahr und falsch lassen sich noch heute kaum zuordnen. Auch wenn die formulierten Partikularinteressen der Beteiligten diesmal auf beiden Seiten berechtigt und plausibel scheinen, wird eines inzwischen klar: Es geht beim Streit um den Kulturpalast-Umbau und der Frage eines zusätzlichen Konzerthauses nicht um Anliegen der Mehrheit der Dresdner. Es geht nicht einmal um Kultur. Kulturelle Einrichtungen wie Staatsoperette oder Musikfestspiele kämpfen mit Gehaltsverzicht, Etatkürzungen oder bleiben ganz auf der Strecke. Staatskapelle und Philharmonie sind zuallererst Standortfaktoren wie Striezelmarkt und Frauenkirche. Im Kern werden ökonomische Entscheidungen gesucht und getroffen.
Der Streit um den Kulturpalast zeigt aber auch eines deutlich: Die Interessenlage einer Mehrheit in dieser Stadt findet nur dann Berücksichtigung, wenn sie mit den Positionen der Stadtverwaltung und der Landesregierung übereinstimmt. Da, wo nicht einmal ausgemacht ist, ob eine Dresdner Majorität auf dem Erhalt der U-Musik im Stadtzentrum besteht oder einem Umzug bereitwillig folgt, wird gar nicht erst gefragt. Veränderungsbereitschaft ist in der Bürgerschaft sehr wohl vorhanden, da wo ehrlich argumentiert wird. Nicht jeder Roland-Kaiser-Fan wird einen Umzug in die Messe ablehnen. Das macht die Sozialdemokraten in diesem Konflikt erneut zu Verlierern. Die Union setzt sich ein weiteres Mal durch, unnötig sekundiert von den Grünen, deren Taktieren gleichfalls wenig aufrichtig wirkt. Der Kulti als Testfall für Schwarz-Grün? Vor allem für die Ökodemokraten eine riskante Angelegenheit: Bürgerliche Wähler, die sie unterstützen, tun das gerade weil sie eine Alternative zur Union suchen. Selbst vorgebliche Haushaltsdisziplin könnte den Grünen noch auf die Füße fallen: Eine defizitäre Klassikausrichtung nach dem Umbau kann kaum die Zustimmung der Bürger finden.
Im Schatten der hochgejazzten Diskussion um den Kulturpalast gibt es von der Königsbrücker Straße bis zum Bürgerradio Coloradio genug Baustellen. Die Frage der Ausrichtung kultureller Begegnung in der Innenstadt fügt sich ein in die Frage nach der geistig-kulturellen Identität Dresdens. Diese nach zwei Diktaturen und 20-jähriger Unionsherrschaft verschüttete, immer wieder aufkeimende und freigelegte, in vielen unbeachteten Nischen sich ausbreitende, stets aber auch fragile Identität ist eine des Tastens und Suchens. Sie braucht den behutsamen, zweckfreien Umgang mit eigener Tradition genauso wie die Öffnung zur Welt aus Neugier heraus und jenseits kommerziellen Verwertungsdenkens. Dass die Landschaft am Fluss Teil eines weltweit geschätzten Kulturguts wurde, war ein elementar wichtiger Schritt auf diesem Weg zur Selbstfindung.
Die Zerstörung der Elbwiesen hat diese Entwicklung abrupt beendet. Die eingezogenen Korsettstangen des Stahlkolosses am Waldschlösschen bringen nicht mehr Beweglichkeit, sondern fixieren eine Bedarfstäuschung der Bürgerschaft, die dafür ihr Einverständnis gab. Eine zweite Chance, den Schaden zu korrigieren, erhielt sie nicht mehr. Als Zeugnis einer seelenlosen, autogerechten Stadt wird diese Lebenslüge der Alternativlosigkeit bei allen weiteren Konflikten mitschwingen; in jedem Wiedergutmachungsversuch der Union, in jeder Beschwichtigungsmaßnahme. Alle weitere Kommunalpolitik trägt den Geruch der Manipulation.
Für das Wohl Dresdens und den inneren Frieden ist es nicht entscheidend, wie der Kulturpalast aussehen wird. Ob wir einen vernünftigen Kompromiss am Waldschlösschen erreichen, bestimmt das künftige Miteinander.