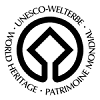Folge dem weißen Kaninchen …
23. Juli 2009
… oder: Wunderland wird aberkannt
von Johannes Hellmich
„Was wollen die Brückengegner jetzt noch erreichen? Dass unsere Stadt mit der Streichung des Dresdner Elbtals aus der Liste der Welterbestätten bestraft wird oder dass der Eintrag in der Liste erhalten bleibt? Wir kämpfen für den Erhalt. Wir fordern die Brückengegner auf, sich in einem ersten Schritt mit uns dafür einzusetzen, dass über den Verbleib auf der Liste der Welterbestätte erst entschieden wird, wenn die Brücke fertig ist.“
„Alle Jahre wieder“ nannte die Bürgerinitiative Pro Waldschlösschenbrücke ihre Pressemitteilung einige Tage vor Sevilla. Das Weihnachtslied sollte wohl die Entscheidungsschwäche des Welterbekomitees illustrieren. Dr. Brauns und Köhler-Totzki glaubten vermutlich bis zuletzt, Herren des Geschehens zu sein. Als falsche Propheten verbreiteten der Richter und sein Lenker munter weiter, dass alles gut wird: „Die Situation ist nicht anders als letztes Jahr. Auch da stand scheinbar unverrückbar fest, dass das Dresdner Elbtal von der Liste der Welterbestätte gestrichen wird, wenn wir weiterbauen. Kurz vor der Sitzung des UNESCO-Komitees war es dann anders.“
Die beiden hatten sich offenbar aus der Wirklichkeit längst verabschiedet. Zwar war die Situation tatsächlich nicht anders. Der Beschluss des Welterbekomitees vom Vorjahr war vom Vertragspartner Deutschland wie von der sächsischen Kulturmetropole in gewohnter Weise schlicht ignoriert worden. In Quebec gelang es dem NGO-Repräsentanten Ralf Weber mit guten Gründen, Hoffnung im Interesse aller Beteiligten zu machen. Diesmal jedoch wollte eine Parteisoldatin ohne jegliche Kompromissbereitschaft mit dem Kopf durch die Wand. Dort war allerdings auch für Milbradts Wunderwaffe kein Durchkommen. Im Endspurt ums Welterbe hatte Helma Orosz die Erfolgschance für den Titelerhalt auf gerade mal 30 Prozent herabgestuft. Zuwenig. Vor deutscher Penetranz in geheime Abstimmung geflüchtet, erteilte eine Zweidrittelmehrheit des Welterbekomitees den weltfremden Forderungen die verdiente Abfuhr.
Hätte ein rechtzeitiges Einlenken der Brückengegner daran etwas ändern können? Meinte man bei der Union allen Ernstes, die UNESCO-Gremien warteten auf Beschlussempfehlungen der Dresdner Elbwiesenfreunde? Aber selbst wer um des Dresdner Ansehens willen Frau Orosz in Carrolls Kaninchenbau folgen wollte, musste schnell steckenbleiben: Welchen Interpretationsspielraum ließen Aachener Gutachten, Rote Liste und der Komitee-Beschluss von Quebec 2008 denn überhaupt zu? Wie sollte man sich die Lügen, die stets so plausibel klangen, zurechtbiegen, die eine unionshörige sächsische Ingenieurskammer zur Tunnelalternative in Umlauf brachte. In den Chor von der Vereinbarkeit der Brücke und des Welterbes einzustimmen hätte auch bedeutet: Im Zweifelsfall sollen Lokalpolitiker nach eigenem Gutdünken bestimmen, was Welterbe ist. Und: Wir retten die Verpackung und verzichten auf den Inhalt. Genau deshalb heißt die Forderung der Bürgerinitiativen bis heute nicht: „Titel retten!“ – sondern: „Welterbe erhalten!“
Eine Gleichschaltung in der Brückenfrage, wie sie bei Sachsens Christ- und Freidemokraten möglich war, eine Brüskierung vermeintlicher Renegaten wie bei der Säuberungsaktion „Totalitäre Eliten“ 2007; all das war in der Welterbebewegung unvorstellbar. Die Freiwilligkeit des Bürgerengagements entzog sich stets berechnender Disziplinierung. Das Ziel des Welterbe- und Elbwiesen-Erhalts ist verantwortliche Übereinkunft unabhängiger Bürger. Der Weg zum Tunnelkompromiss war für manchen schwer genug, der von Brauns und Köhler-Totzki geforderte erste Schritt also längst getan. Räson bleibt auf diesen Tag: Was nützt dieser Stadt und ihren Bürgern. Politisches Lavieren blieb schon deshalb unmöglich. Schon der Begriff Brückengegner suggeriert eine Verschworenheit, gar eine Borniertheit, die zu keinem Zeitpunkt bestanden. Schock und Wut über die Dimension des Bauvorhabens und die Kaltschnäuzigkeit der Union in Stadt und Land saßen gleichwohl bei vielen tief. Interventionsversuche, den verkehrspolitischen Größenwahn zu stoppen (auch von der UNESCO, als erhoffte Stimme der Vernunft), hätte es zweifellos auch ohne Günter Blobel gegeben. Der amerikanische Freund Dresdens muss nicht entlastet werden. Aber: in ihm den Schuldigen zu sehen, zeigt einmal mehr die Verlogenheit der Kläger. Die Internationalisierung der Konfrontation war gar nicht zu vermeiden, denn Dresden selbst suchte seit vielen Jahre Anschluss an die Welt und ihre Hilfe.
Dass der Konflikt überregional ausgetragen wurde, lag nicht an einer Mentalität des Nestbeschmutzens, sondern vor allem an der Gesprächsverweigerung von Stadtverwaltung und Staatsregierung. Die begründeten Bedenken vieler – auch prominenter – Bürger wurden überheblich beiseite geschoben. Gerade Funktionäre und Repräsentanten der Union berauschten sich stattdessen zunehmend an einem irrationalen Bild Dresdens als Nabel der Welt, das mit Frauenkirche, Grünem Gewölbe und ein bisschen Hightech-Industrie glaubte, nun selbst Maßstäbe setzen zu müssen. Aus einer bürgerlich-humanistischen Großstadt mit protestantischer Selbstbescheidung wurde eine Kulisse für herausgeputztes Politstadl. Aus Kunst ist Künstlichkeit geworden. Die unüberschaubare Fülle immer größerer Events und Kuriositäten können die Leere dieses Wunderlandes nicht ausfüllen. Die Zerrissenheit seiner Bürgerschaft und verlorengegangenes urbanes Kulturverständnis sind nicht durch Marketingaktionen und Gute-Laune-Aufrufe zu heilen.
Während die Risse auch in der Fiktion vom Wirtschaftswunder immer größer werden, bleibt die Realisierung der Waldschlösschenbrücke offenbar weiter wichtigste Herausforderung der Regierenden. Eine sozialistisch anmutende Schilderung von Baufortschritten und die euphorische Begrüßung angelieferter Stahlteile als Daily Soap in der Lokalpresse lassen den Beobachter verwundert die Augen reiben. Gerade hat Dresden seinen Ruf als Kulturmetropole verspielt – und der Leser wird über die kleinen Gewohnheiten der Brücken-Brummifahrer unterrichtet. Jeder, der die Baustelle besucht, kann sehen, dass es fast unmöglich geworden ist, den Tunnel und das Welterbe zu retten. Was bezweckt diese Begleitmusik?
Gibt es in dieser Situation noch Hoffnung auf den so lange ersehnten Kompromiss? In Carroll’s Erzählungen sagt Alice zur weißen Königin, es sei unmöglich, sich rückwärts durch die Zeit zu bewegen. Die weiße Königin antwortet ihr, Unmögliches zu glauben, sei nur eine Sache der Übung. Als sie selbst jung war, habe sie schon vor dem Frühstück bis zu sechs unmögliche Dinge geglaubt. Ob das Wunderland, in das uns die sächsische Union geführt hat, realer ist, als die Bewahrung des Welterbes, muss sich noch herausstellen. Ob wir ein Stück umkehren können, um neu zu beginnen, wird sich im Herbst zeigen. Die klagenden Umweltverbände verdienen unsere Solidarität. Bis dahin darf am Unmöglichen festgehalten werden.
Carrolls weißes Kaninchen begegnet uns in einer modernen Geschichte wieder. Dort führt es den Helden Neo, anders als Alice, in die Wirklichkeit. Sollten Sie also nachts an der Dresdner Oper wiederholt riesige Stahlteile vorüberhuschen sehen, schenken Sie dem keine besondere Beachtung, es ist vielleicht nur eine Störung der Matrix.