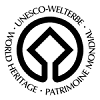Mit den im folgenden angeführten Punkten soll der Hintergrund und der Entstehungsweg des Dresdner Brückenstreits noch einmal kurz und übersichtlich dargestellt werden.
Zur Durchsetzung des Baus der Waldschlößchenbrücke
Die durchgängige Ausweisung des gesamten Flusslaufes der Elbe auf dem Gebiet Sachsens als europäisches Vogelschutzgebiet – mit der einzigen Ausnahme eines kurzen, innerstädtischen Abschnitts in Dresden – zeigt, dass bereits zu einem frühen Zeitpunkt Planungshindernisse für die Waldschlößchenbrücke aus dem Weg geräumt werden sollten.
Kartenmaterial von 1995 weist noch den gesamten Elbraum als „denkmalgeschützten Bereich“ aus. Im Jahr 1999 sprechen das städtische Denkmalamt im Einvernehmen mit dem Landesamt für Denkmalpflege von einer „überaus empfindlichen Beschneidung des typischen weiträumigen Stadt-Landschaftsbildes“ durch den geplanten Brückenbau. Auf wundersame Weise ändert sich jedoch die Meinung der amtlichen Denkmalschützer. Das Areal der Waldschlößchenwiese wird aus dem denkmalgeschützten Bereich ausgespart und 2003 lautet dann plötzlich das Urteil: „aus denkmalpflegerisch konservatorischer Sicht bestehen gegen das [Brückenbau-] Vorhaben keine Einwände.“ Nicht ohne Bitterkeit stellten sie im Jahr 2006 fest, dass das sog. „Aachener Gutachten“ ihre ursprüngliche Einschätzung bestätigt.
Das Verkehrskonzept, aus dem die Notwendigkeit des Brückenbaus abgeleitet wird, stammt aus dem Jahr 1994. Seitdem haben sich die Verkehrszahlen drastisch verändert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit des innerstädtischen Verkehrs in Dresden gehört zu den deutschlandweit höchsten. Gern wird zudem die Entlastung des vorgeblich baufälligen Blauen Wunders als eines der Hauptziele des Brückenbaus angeführt; jedoch erwarten Studien, die selbst von den Brückenbauern angeführt werden, eine Abnahme der Verkehrs auf dem Blauen Wunder von nur 10% bei gleichzeitiger Zunahme des Verkehrs parallel zur Elbe über den Schillerplatz.
In einer ersten Phase der Auseinandersetzung mit der Tunnelalternative wurde ihre Machbarkeit mit vollkommen abstrusen Argumenten grundsätzlich in Zweifel gezogen – obwohl bereits bei der Abwägung im Planfeststellungsbeschluss zum Brückenbau ein Elbtunnel als machbare (wenn auch nicht vorzugswürdige) Alternative angeführt wird. Spätestens seit der Fachklausur „Elbtunnel Dresden“ am 06.03.2008 an der TU Dresden steht außer Frage, dass der Bau eines Elbtunnels ein realistisches Szenario darstellt.
Als „Fachinstanz“ zur Rechtfertigung derartiger Positionen wurde die Ingenieurkammer, welche personell mit der Bürger-Initiative Pro Waldschlößchenbrücke verflochten ist, in Stellung gebracht. Sie vertrat fachlich vollkommen unhaltbare Positionen, erfuhr jedoch keinen Widerspruch aus Fachkreisen, weil insb. selbständige Ingenieure mit ihrer beruflichen Exstenz von der Kammer abhängig sind.
In einer zweiten Phase konzentrierten sich die Kritiker auf vermeintliche Mehrkosten für einen Tunnelbau. Häufig ist von „mindestens 100 Millionen Euro“ die Rede. Der Dresdner CDU-Chef Lars Rohwer verstieg sich sogar zu einer Schätzung von über 200 Millionen Euro – dabei haben selbst die von der Stadt Dresden bestellten Gutachter im Verfahren der Naturschutzverbände vor Gericht bestätigt, dass die Mehrkosten bei 29 bis 38 Millionen Euro liegen.
In einer dritten Phase wurde (mit Verweis auf das Urteil des Verwaltungsgerichts im Verfahren der Naturschutzverbände) behauptet, der Elbtunnel sei „nicht genehmigungsfähig.“ Das ist auch Kern der Argumentation, mit welcher die Oberbürgermeisterin Helma Orosz ihr Vorgehen vor dem UNESCO-Welterbekomitee im Sevilla rechfertigen möchte. Das tut sie, obwohl mittlerweile drei Gutachten (von Prof. Bernhard Rauch, von Prof. Martin Gellermann sowie von Prof. Alexander Schmidt) belegen, dass so etwas aus dem Urteil keineswegs herauszulesen ist und obwohl das UNESCO-Welterbezentrum in Paris über diese Tatsache umfassend informiert ist.
Zur Meinungsbildung in Dresden
Der Kommunikationswissenschaftler Prof. Wolfgang Donsbach von der TU Dresden veröffentlicht regelmäßig Umfragen zu politisch relevanten Fragen. Da er selbst Kommunikationskonzepte im Auftrag der CDU entwickelt und Teile seines Lehrstuhls von der CDU-nahen Konrad-Adenauer-Stiftung finanziert werden, ist seine eigene Haltung nicht neutral. Seine Umfragen genügen wissenschaftlichen Mindestanforderungen an Transparenz und Reproduzierbarkeit nicht. Sie geben daher nicht das Meinungsbild in Dresden wieder – vielmehr sind sie selbst Mittel der Meinungsbildung.
Im Sommer 2008 kam eine Umfrage des Soziologen Prof. Karl-Siegbert Rehberg von der TU Dresden zu dem (für alle Seiten überraschenden) Ergebnis, dass sich eine Mehrheit der Dresdner Bevölkerung unter einhaltbaren Vorbedingungen (Machbarkeit und Finanzierbarkeit) für den Bau eines Elbtunnels ausspricht – insbesondere im Hinblick auf die Erhaltung des Welterbe Dresdner Elbtal. Genau diese Mehrheit der Dresdner Bevölkerung ist es, welche durch die Blockierung des Bürgerentscheids zur Tunnelalternative daran gehindert wird, ihre Meinung zu artikulieren und durchzusetzen.
Die Dresdner Lokalpresse hat es bis auf Einzelfälle nicht geschafft, den Diskussionsprozess um die Waldschlößchenbrücke und das Welterbe sachlich, distanziert und kritisch zu begleiten. Vielmehr gibt sie die Auffassungen der verschiedenen Konfliktparteien regelmäßig unreflektiert und zu oft fehlerhaft wieder. Es bleibt offen, ob das nur ihrem Unwillen oder gar ihrem Unvermögen zuzuschreiben ist, sich mit diesem für Dresden bedeutsamen Thema tatsächlich auseinanderzusetzen.
Namhafte und verdienstvolle Persönlichkeiten aus Kultur und Wissenschaft, die sich für eine welterbeverträgliche Elbquerung einsetzen, werden von Dresdner CDU- und FDP-Bundestagsabgeordneten öffentlich und in unflätigster Weise beschimpft. Für den Welterbeerhalt engagierte Dresdner werden bedrängt und in ihrer beruflichen Existenz bedroht. Gerichtsverfahren werden gezielt eingesetzt, um die Welterbe-Bewegung zu behindern und ihren Handlungsspielraum einzuschränken.
Zum Verhalten der Bundespolitik
Bundespräsident Horst Köhler ist nach eigenem Bekunden über den Dresdner Welterbekonflikt umfassend informiert. Das muss die internationale Wirkung des Vorganges zwangsläufig einschließen. Dass er sich dennoch nicht positioniert, kann nur mit Parteienlogik erklärt werden: Da der Welterbe- oder Tunnelkompromiss absurder Weise dem linken Lager zugeordnet wird, blieb für Horst Köhler (genauso wie für Angela Merkel) kaum Spielraum, sich gegen die „wahren Demokraten“ um Arnold Vaatz, Kurt Biedenkopf usf. durchzusetzen. Einen Verstoß Deutschlands gegen Artikel 4 bis 7 der UNESCO-Welterbekonvention nimmt er dabei billigend in Kauf.
Bundeskanzlerin Angela Merkel meint auch: „Eine Streichung des Dresdner Elbtals aus der Welterbeliste würde das Ansehen Deutschlands und das Verhältnis Deutschlands zur UNESCO erheblich beeinträchtigen.“ Auch nach ihrer Auffassung sind Sachsen und Dresden an die Welterbekonvention gebunden und brechen mit ihrem Vorgehen Völkerrecht. Gleichwohl unternimmt sie nichts, ihre hiesigen Parteifreunde daran zu hindern. Auch ihre Haltung lässt sich nur aus der Interessenabwägung heraus erklären.
Das Auswärtige Amt hat mehrfach und nachdrücklich versucht, auf die Sächsische Landesregierung Einfluss zu nehmen. Nicht nur von dieser Seite ist die mangelnde Kompromissfähigkeit der sächsischen Regierungsvertreter wiederholt beklagt worden. Auch Außenminister Frank Walther Steinmeier sieht Sachsen in der Pflicht, äußert sich dazu aber nicht öffentlich. Es ist anzunehmen, dass für ihn der Verlust des Welterbes politisch besser zu verwerten ist, als ein Engagement im Ringen um seinen Erhalt.
Der Dresdner Bundestagsabgeordnete Jan Mücke nutzt mit einer gewissen Regelmäßigkeit Anfragen im Deutschen Bundestag, um vorgeblich die Bundespolitik zu einer Positionierung im Dresdner Brückenstreit zu zwingen. Immer wieder sind seine Anfragen bewusst irreführend formuliert, zum Teil stellt er Sachverhalte falsch dar. Derartige Anfragen dienen ausschließlich der eigenen Profilierung und haben bislang in keinem Fall konstruktiv zu einer Lösung des Welterbekonflikts in Dresden beigetragen.
Zu juristischen Aspekten
Für renommierte Juristen steht die Bindungswirkung der Welterbekonvention vollkommen außer Frage. Die (Schutz-) Behauptung der Brückenbauer, Dresden und Sachsen seien nicht an die Welterbekonvention gebunden und damit gar nicht zum Schutz und Erhalt des Welterbes Dresdner Elbtal verpflichtet, entbehrt nicht nur jeglicher Grundlage – sie ist auch widersinnig, weil es doch Dresden und Sachsen selbst waren, die sich um den Welterbetitel beworben und sich damit bewusst den Regularien der UNESCO unterworfen haben.
Für renommierte Juristen steht außer Frage, dass auch mit Mitteln der direkten Demokratie nicht gegen internationale Verträge verstoßen werden darf. Bürgerentscheide, mit denen Völkerrecht gebrochen wird, sind schlicht unzulässig. Das Bundesverfassungsgericht nahm eine diesbezügliche Verfassungsbeschwerde nicht zur Entscheidung an und hielt es lediglich für „verfassungsrechtlich möglich,“ dass sich ein Bürgerentscheid durchsetzt, „wenn zuvor in einem Verhandlungsprozess erfolglos nach einer Kompromisslösung gesucht wurde“ – was nie wirklich geschehen ist. Die zum Kompromiss hochstilisierte „Burger-Brücke“ hat in der Öffentlichkeit bestenfalls ein Kopfschütteln ausgelöst, weil selbst für geübte Beobachter der Unterschied kaum erkennbar war. Die Schöpfer dieses „Kompromisses“ haben sich zwischenzeitlich fast alle von dieser Form der Kompromisssuche distanziert (einschließlich des ehem. Baudirektors der Frauenkirche, Eberhard Burger).
Es gibt kein Gerichtsurteil, welches die Unzulässigkeit des Elbtunnel-Bürgerbegehrens feststellt, sondern nur die Entscheidung, dass das Bürgerbegehren nicht mit einer einstweiligen Verfügung herbeigeführt werden kann. Die Gerichte sagen nur, dass die Brücke gebaut werden kann. Kein Gericht sagt, dass die Brücke gebaut werden muss, oder dass der Tunnel nicht gebaut werden darf.
Zum Umgang mit der UNESCO
Die Behauptung, die UNESCO sei von Anfang an über die Brückenplanungen informiert gewesen, ist die Lebenslüge der Brückenbauer. Sie ist zweifelsfrei widerlegt. Der Besuch der ICOMOS-Gutachter im Rahmen der „Reinforced Monitoring Mission“ am 04./05.02.2008 in Dresden verlief vollständig abgeschottet von der Öffentlichkeit. Die Vertreter der Landeshauptstadt und des Freistaates hatten demnach zwei Tage lang optimale Bedingungen, um Missverständnisse auszuräumen und für ihren „Kompromiss“ zu werben. Das Urteil der Gutachter fiel dennoch unmissverständlich aus: Der Brückenbau zerstört das Welterbe Dresdner Elbtal. Ein Welterbe-Erhalt ist nur mit dem Elbtunnel möglich.
Die Lokal- und Landespolitik lässt keinerlei ehrliche Bemühung um eine Verbreitung des Welterbegedankens erkennen. Das steht im Widerspruch zu den Verpflichtungen, die sich aus Artikel 5 der UNESCO-Welterbekonvention ableiten. Auch Veranstaltungen wie der Welterbetag können nicht darüber hinwegtäuschen, dass ausnahmslos alle von der Stadtverwaltung abhängigen Personen und Institutionen systematisch behindert werden, sobald sich ihr Engagement für das Welterbe gegen den Brückenbau richtet. Nach wie vor profilieren sich Politiker in Dresden damit, die UNESCO als undemokratisch zu diffamieren. Das wirft ein Schlaglicht auf ihre Gedankenwelt und lässt erahnen, wie sie die Dresdner (respektive ihre Wähler) einschätzen. Und das Verhalten der Politik zeigt Wirkung: Eine Mehrheit der Dresdner hält den Welterbetitel für verzichtbar, wie eine Umfrag am 19.06.2009 ergab.
Der Beschluss des Welterbekomitees in Quebec im Juli 2008, das Welterbe Dresdner Elbtal könne nur mit einem sofortigen Baustopp für die Brücke erhalten werden, lässt keine Deutungen zu. Wenn Politiker – allen voran Helma Orosz, Lars Rohwer und Jan Mücke – dennoch glauben machen, es gäbe noch Verhandlungsspielraum und man wolle für den Welterbetitel kämpfen, dann ist das bewusste Wählertäuschung. Es zeugt gleichwohl nicht von maßloser Selbstüberschätzung: Nein, das Zerwürfnis mit der UNESCO wurde von den Sächsischen Ministerpräsidenten Kurt Biedenkopf und Georg Milbradt systematisch vorbereitet – erinnert sei nur an die unsäglich arroganten Bemerkungen vom „verzichtbaren“ Welterbe – und von der Dresdner Politik bewusst und gezielt herbeigeführt.